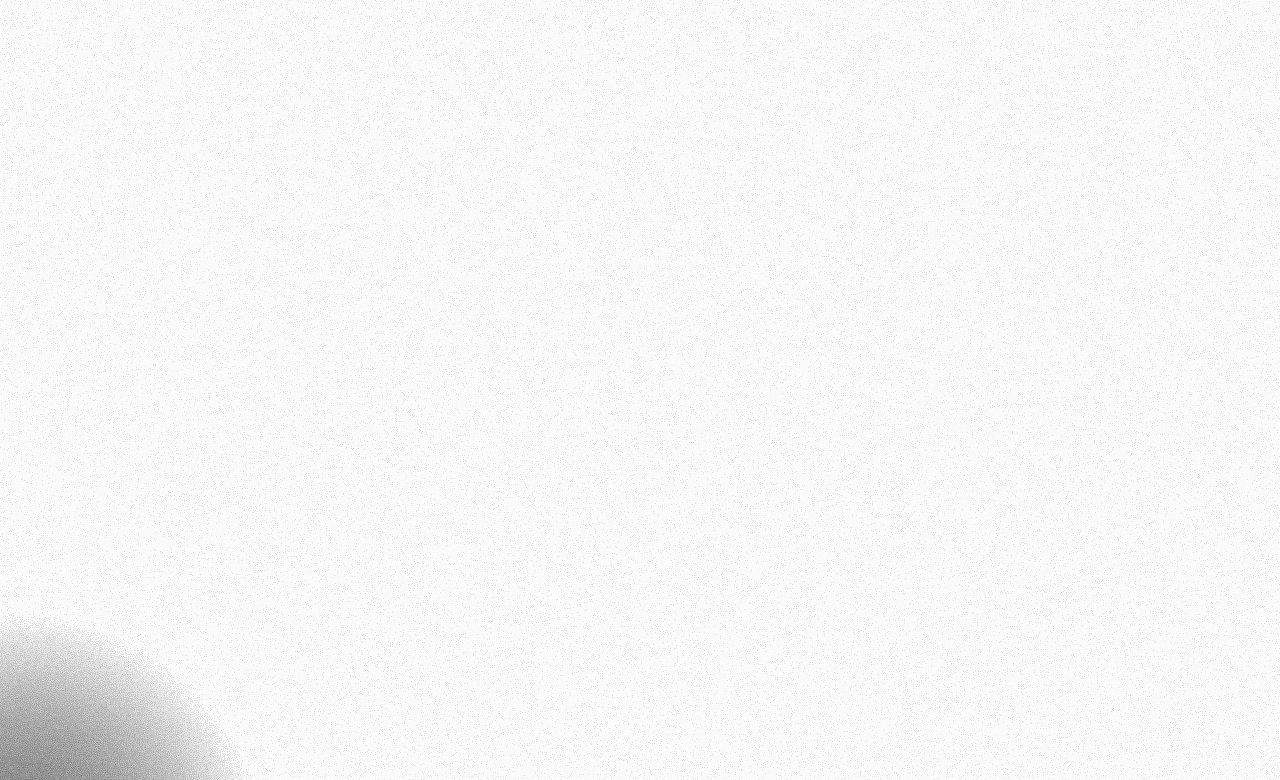Verbotene Schnittstelle
Es hat an der Wiener Akademie eine Zeit gegeben, in der die Studierenden im Dissertantinnenseminar – in meinem nämlich –, sobald sie den Begriff der „Schnittstelle“ fallen ließen, einen Euro in die Kaffeekasse zahlen mussten. Eine solch krasse Vorschrift, die in schroffem Gegensatz zu gebotenen Regeln in einer derartigen Runde steht, schreit natürlich nach einer Begründung, in allen Details. Zumal darüber hinaus auch noch die um einiges groteskere Regel Bestand hatte, dass diejenigen, die die „Schnittstelle“ etwa in Wendungen kombinierten wie: „X operiert an Schnittstellen zu …“ (eine damals überaus häufig herangezogene, ja strapazierte Wendung im Theorie- und Kunstbereich. Glücklicherweise ebben solche Wellen wie von selbst ab) zwei Euro in die Kasse tun mussten. Die Studierenden müssen gedacht haben, es handele sich um einen Begriff von äußerster Tragweite, dem daher ein engagiertes persönliches Tribunal meinerseits errichtet worden ist. „Schnittstelle“ sei von höchster philosophischer Brisanz, etwa wie Pantheismus oder Epoché. Wie also diese zwei Absonderlichkeiten in meiner policy, Regeln zu erlassen, begründen – wo ich sonst eher alle reden lasse, wie es ihnen gefällt?
Ich kann nicht umhin, zum Zwecke der Erhellung dieses mir inzwischen selbst dubiosen Umstandes meine eigene Betroffenheit, die unmittelbar einsetzte, wenn das Wort „Schnittstelle“ fiel, offenzulegen. Während die meisten meiner Kolleginnen in der „Schnittstelle“ einen funktionalen Ort in einer medientheoretisch gedachten Architektur von Ebenen, Bedeutungen, vielleicht auch Substanzen mit Informationsgehalt sahen, kam mir immer nur das vormoderne Bild einer Wunde unter. Die Schnittstelle, so dieses Bild, war da eine Stelle, welche soeben von einem Messer oder Skalpell verlassen worden war. Während die einen also sich befriedigt über die neue Stoßrichtung des Wortes in einer Welt ausufernder technischer Konnektivität sich anschickten, es immer häufiger einzusetzen, ließ mich das so brutal organisch geladene Wort regelmäßig zusammenzucken. Der Hang zur verbalen Grausamkeit, den die Medientheorie der neunziger Jahre auszeichnet, schien mir geradezu vorbildlich in der Beliebtheit von „Schnittstelle“ manifestiert. Das „elektronische Fleisch“, welches da nach A. Kroker gemeint gewesen sein könnte, wurde in Schnittstellen-Debatten munter okuliert, gepfropft und hybridisiert, „Schnittstellen“ wurden überall ausfindig ausgemacht und verschwenderisch hergestellt. Meine Theorie-Schmerzen waren furchtbar.
Was aber war diese „Schnittstelle“? Ein neuralgischer Ort sollte sie sein, an welchem Unterschiedliches aufeinandertrifft, so wie der Finger des Thomas, der in die Herzwunde Christi tippt, beide Seiten in diesem Schnittstellenmoment extrem empfindlich, reaktiv. Zwei verschiedene Wundenbesitzer, nicht nur zwei Wundränder am selben Leib machen die Schnittstelle aus. Das damals, in den 90ern, so beliebte Wort kam dem Interesse nach Fusion unterschiedlicher Gebiete entgegen, dem Gebot, Brücken in einem steilen, möglichst interdisziplinären Theoriegelände zu bauen. Wenn man es gut mit ihm meint, dann könnte man sagen, der Begriff der „Schnittstelle“ markiere die paradigmatische Wende, oder besser: leuchtete nach Art eines Wetterleuchtens (das Unwetter war noch weit weg) eine paradigmatische Wende ein, nämlich diejenige, die das Zeitalter der Differenz an das ihr nachfolgende der Fusion anschließt.
Die Schnittstelle bezeichnete zweifelsohne in den 90er Jahren (das war wohl das Jahrzehnt ihres Triumphes) den biopolitischen Ort des Hybriden, welcher sich zwischen Hochfrequenzsteckern, elektronischen Steuerebenen und Okuliertem aller Art (!) erstreckte, ein Informations- und Übermittlungswunder, welches zugleich den Schnitt und seine Überwindung meinte. Index des Monströsen, des Trans, der Verschweißung des Verschiedenen, des Niederreißens der natürlichen Beständigkeit der Art. Die Fusion (Heilung der Schnittstelle) ereignet sich durch Hochfahren der Energie, die dann überspringt, durch die Stecker geht, ohne Reibungsverlust. Schnittstelle – und das wäre nun das Versöhnlichste, das man sagen könnte – bedeutet in einem die Differenz und die Entdifferenzierung im Sinne der Vereinigung. In der Tat, es könnte dieses Wort – trotz seiner wirklichen Scheußlichkeit, welche mir auch von der bedeutendsten Dichterin Österreichs Friederike Mayröcker aus Anlass dieses Aufsatzes telefonisch bestätigt wurde – einmal als Hinweis, als Symptom verstanden werden. Es wird dadurch nicht besser, aber man verstünde besser, weshalb alle danach gierten, es so oft wie nur irgend möglich zu verwenden, einzusetzen, damit zu glänzen (das konnte man damals, in den 90ern!).
Wenn nun aber dieses Wort – welches man nicht zu oft wiederholen sollte – eine solche paradigmatische Wende zumindest indexhaft, symptomatisch angezeigt haben soll, wieso habe ich es dann aus dem gelehrten Sprachgebrauch meiner DissertantInnen gezielt ausgeschieden, anstatt sie anzuhalten, den Begriff zu frequentieren? Ist derlei entschuldbar? Wodurch ist diese meine Sabotage zu erklären?
Es hat etwas gedauert, bis ich endlich vorgestoßen bin zur Erklärung, obgleich sie nahelag. Ich hatte selbst mich einer längeren und schwierigen Operation unmittelbar nach dem Abschluss meiner Studien mit dem Doktorat unterziehen müssen, was mir wie die absolute Antithese zur Identität einer Philosophin vorgekommen war. Der kurze Prozess, den die Narkose mit meinem sich intensiv ihr entgegensetzenden Denken machte – das war eine Schnittstelle, die sich in mich wirklich hineingeschnitten hatte, und zwar so, dass mir die Fragilität des Geistes wie nie zu Bewusstsein (welches durch Bewusstlosigkeit bedroht war) gekommen war. Mir, die ich geglaubt hatte, der Geist überwinde alles, widersetze sich allem, sei unendlich und mächtig.
In meinem Bildhaueratelier eröffnete ich dann Jahre später ein Schnittstellenparadies, dessen Herkunft aus dem Protest gegen die „Operation“ am besten durch mich selbst verschleiert wurde, unterstützt durch dubiose, im DissertantInnenseminar ausgegebene Regeln. In einer Aktion im Jahr 2016 (DISLIKE MYSELF TERROR ACT / WANT MYSELF BEAUTIFUL DESIRE SCULPT, Museum für Angewandte Kunst Wien, kuratiert von Robert Punkenhofer) habe ich mich selbst als Skulptur operiert, nachdem ich mich im Jahr zuvor öffentlich narkotisieren habe lassen (THE SYMPTOM AND THE CURE, Kunstraum Niederösterreich, kuratiert von Christiane Krejs). Also, wenn sie es noch immer wollten, wäre die Verwendung des Begriffs „Schnittstelle“ – abgesehen von literarischen, ästhetischen, möglicherweise auch von inhaltlichen – durch meine DissertantInnen heute absolut kein Problem mehr für mich.